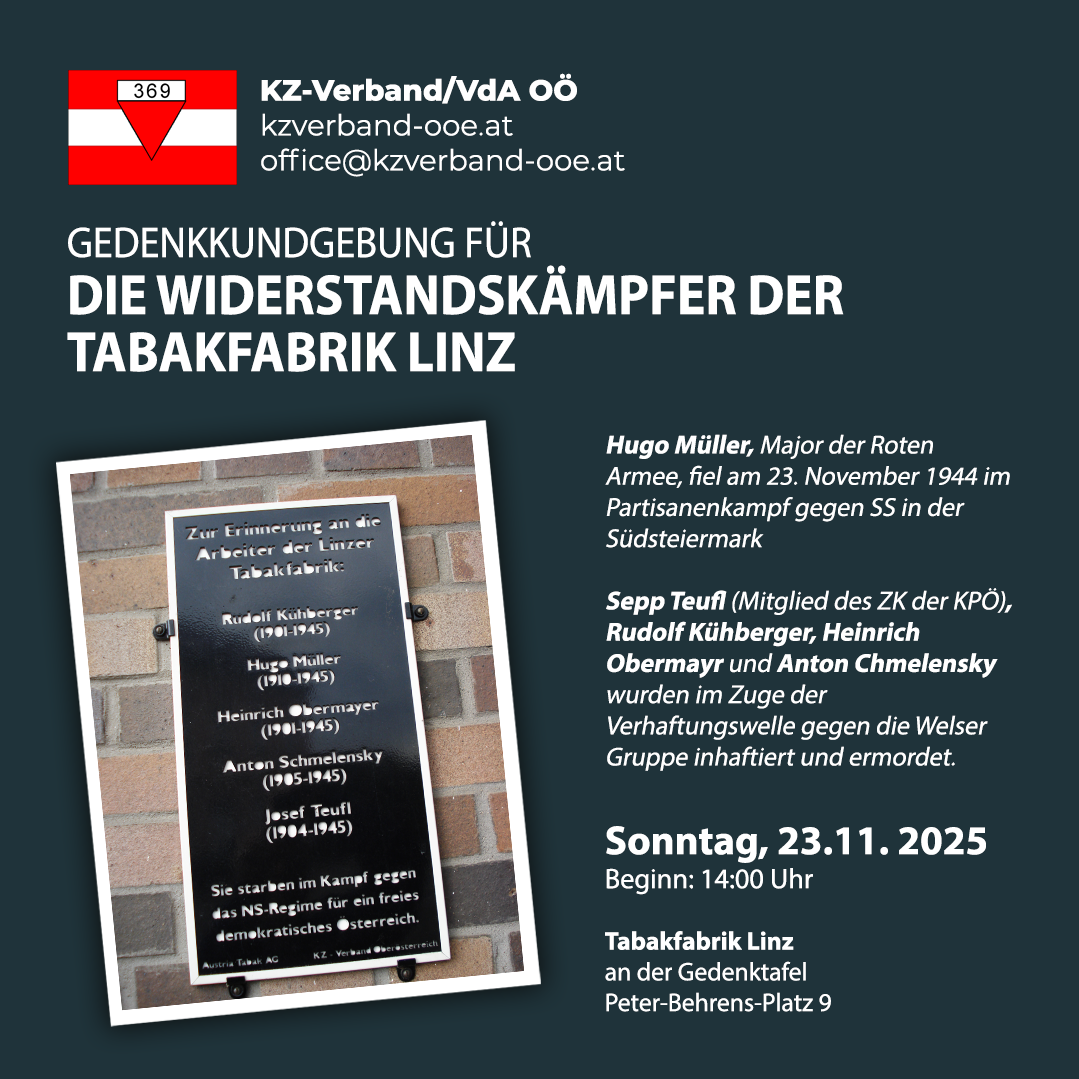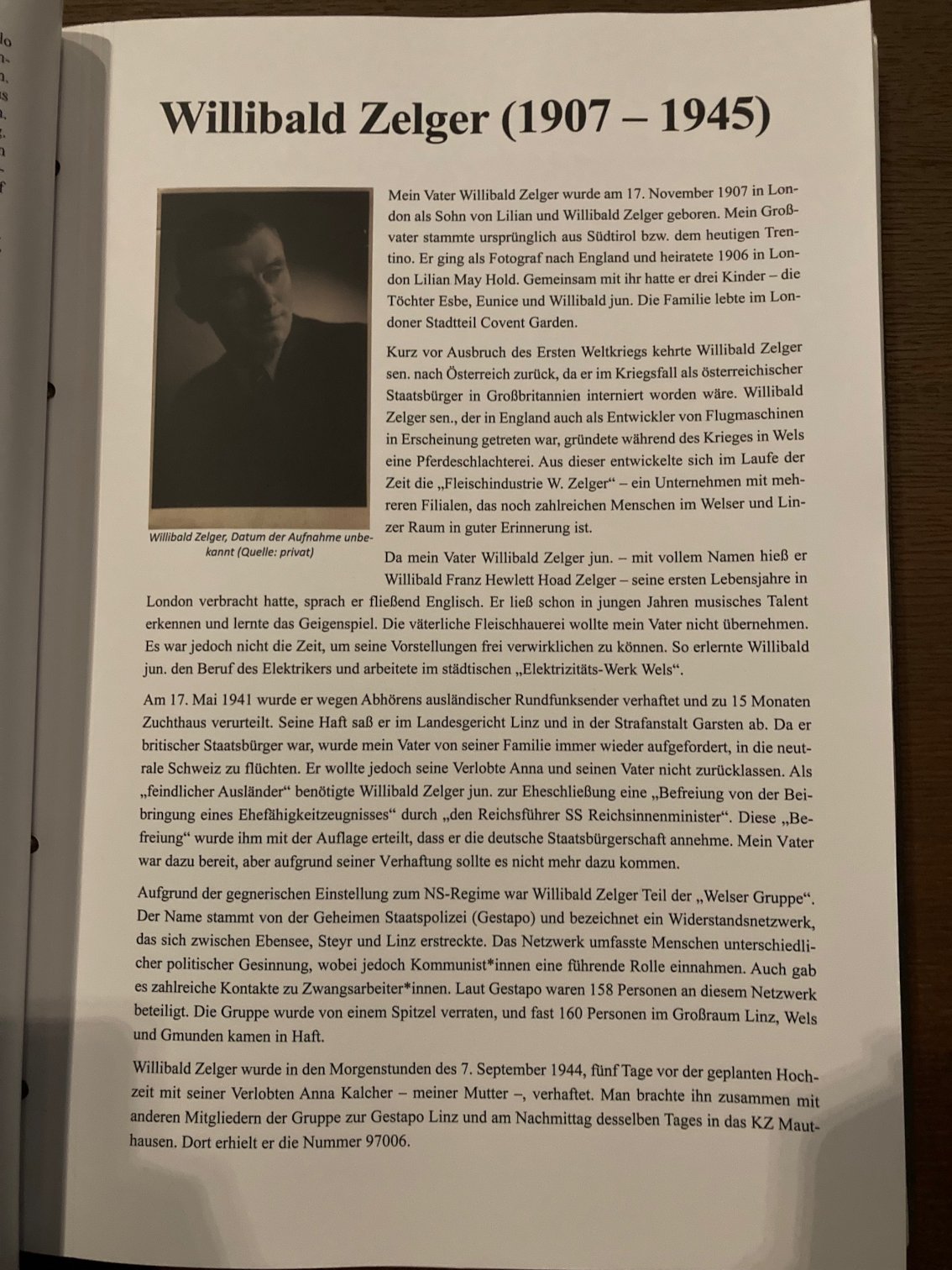Am Freitag, 25. April 2025 ehrte der KZ-Verband/VdA Oberösterreich anläßlich des bevorstehenden 80. Jahrestags ihrer Ermordung die Widerstandskämpferinnen Risa Höllermann und Gisela-Tschofenig-Taurer beim Denkmal des Arbeitserziehungslagers Schörgenhub. Das Denkmal, errichtet von der Stadt Linz, erinnert der Opfer des Arbeitserziehungslagers Schörgenhub der Gestapo, das an der Siemensstraße im Mai 1943 errichtet wurde. Die Bewachungsmannschaft setzte sich vor allem aus ukrainischen SS-Leuten und Volksdeutschen aus dem Banat zusammen.
Das Arbeitserziehungslager Schörgenhub diente vor allem zur Bestrafung und Disziplinierung von Zwangsarbeitern, die in den Linzer Rüstungsbetrieben eingesetzt waren, etwa wegen sogenannter Arbeitsflucht oder Arbeitsverweigerung („Bekämpfung des Arbeitsvertragsbruches ausländischer Arbeiter“).
Nach den Bombardierungen des Polizeigefängnisses am 20. Jänner 1945 und des Frauengefängnisses Kaplanhof am 31. März 1945 wurden die überlebenden politischen Gefangenen in das Arbeitserziehungslager Schörgenhub verlegt. Bei den Bombardierungen wurden die Häftlinge in ihren Zellen eingesperrt und den Bomben schutzlos ausgeliefert. Bei der Bombardierung am 31. März 1945 kamen mehr als die Hälfte der Häftlinge des Kaplanhofs ums Leben. Schörgenhub wurde damit zu einem erweiterten Polizeigefängnis. Etwas abseits vom „Männerlager“ wurde ein getrennter Bereich für die inhaftierte Frauen geschaffen, die Frauenbaracken war durch Stacheldraht getrennt.
Das Areal des AEL umfasste knapp zwei Hektar. Für die Zeit bis 1944 waren ungefähr zwischen 300 und 500 Männer inhaftiert, nach den Bombardierung des Linzer Polizeipräsidiums und der Zerstörung des Polizeigefängnisses in der Mozartstraße am 20. Jänner 1945 wuchs das Arbeitserziehungslager Schörgenhub zeitweise auf über 1000 Insassen an und wurde zunehmend zu einem erweiterten Polizeigefängnis. Insgesamt waren in Schörgenhub 6000 bis 7000 Personen inhaftiert.
Am 27. April 1945 wurden auf direkten Befehl des Gauleiters – „um keine aufbauwilligen Kräfte zu hinterlassen“ – die führenden kommunistischen Widerstandskämpferinnen Gisela Tschofenig-Taurer und Risa Höllermann und mit vier weiteren Häftlingen im Lager hingerichtet. Am 3. Mai 1945, zwei Tage vor der Befreiung von Linz, wurde die Häftlinge, vor allem Zwangsarbeiter, entlassen.
Niemals vergessen: Risa Höllermann (1906-1945)
Risa Höllermann wurde am 23. Juni 1906 geboren und wohnte mit ihrem Gatten Hermann und den zwei Kindern in Wels. Hermann Höllermann bildete ab 1942 mit Karl Scharrer, Karl Mischka und Ludwig Hartl die illegale Landesleitung der KP Oberösterreich. Risa Höllermann fungierte in zentraler Rolle als Kurierin der Widerstandsbewegung und wurde am 7. September 1944 im Zuge der Verhaftungswelle gegen die von der Gestapo als „Welser Gruppe“ bezeichnete weitverzweigte Widerstandsorganisation direkt an ihrem Arbeitsplatz im Bahnhofsrestaurant Wels verhaftet. Die Tochter verblieb bei einer Bekannten, ihr außerehelicher Sohn wurde von Risas Vater nach Kärnten geholt. Während ihr Mann Hermann Höllermann bereits am 18. September 1944 auf der Todesstiege von Mauthausen ermordet wurde, kam Risa nach Verhören schließlich nach Schörgenhub und wurde am 27. April 1945 auf direkten Befehl – „um keine aufbauwilligen Kräfte zu hinterlassen“ – gemeinsam mit Gisela Tschofenig-Taurer und weiteren vier Häftlingen hingerichtet.
Niemals vergessen: Gisela Tschofenig-Taurer (1917-1945)
Gisela Taurer wurde am 21. Mai 1917 in der Nähe von Villach in einer Eisenbahnerfamilie geboren. Ihr Vater wurde 1935 wegen politischer Unzuverlässigkeit von Villach nach Linz versetzt und wohnte zuerst in Linz und ab 1936 in Leonding. Von April 1937 bis April 1938 hielt sie sich in Lyon auf, wo sie versuchte, zu den Interbrigaden zu gelangen, was ihr aber mißlang. Sie hatte eine gute Schulausbildung und war von 1938 bis 1939 am Linzer Hauptbahhof als Kassiererin tätig. Sie war zuerst im KJV, danach in der KPÖ altiv. Sie leistete wichtige Kurierdienste für Sepp Teufl, Mitglied des ZK der KPÖ. Durch ihre Französisch-Kennznisse konnte sie Kontakt mit den Fremdarbeitern in den Hermann-Göhring Werken halten.Im Juli 1939 reiste nach Belgien und lebte dort ein Jahr mit ihrer Jugendliebe Josef Tschofenig, der als KJV-Funktionär flüchten musste. Gisela kehrte schwanger zu ihren Eltern nach Linz zurück, wo am 19. Dezember 1940 ihr Sohn Hermann zur Welt kam. Am 3. Juni 1944 heiratete sie Josef Tschofenig im Standeamt des KZ Dachau und ihr Sohn Hermann erhielt am 6. Juni 1944 die Stellung als eheliches Kind. Aus Sicherheitsgründen musste sie sich von der illegalen Arbeit zurückziehen und zog nach Kärnten zur Familie ihres Mannes. Im Zuge der Verhaftungswelle gegen die Welser Gruppe wurde sie am 25. September 1944 von der Gestapo in Kärnten verhaftet und im Frauengefängnis Kaplanhof eingesperrt.Sie überlebte den Bombenangriff vom 31. März 1945 und wurde nach Schörgenhub überstellt. Am 27. April 1945, wenige Tage vor der Befreiung, wurde sie gemeinsam mit Risa Höllermann und weiteren vier Häftlingen auf direkten Befehl hingerichtet. Am 13. Mai 1945 wurden die Leichen von Vater Taurer exhumiert.
In Wels erinnert die Risa-Höllermann-Straße, in Linz der Tschofenigweg an diese unbeugsamen Widerstandskämpferinnen, die Ihr Leben im Kampf gegen den Faschismus lassen mussten.
Risa Höllermann und Gisela Tschofenig-Taurer nahmen als österreichische kommunistische Widerstandskämpferinnen die größten Opfer auf sich, um jenen Beitrag zur Abschüttelung der deutschen Fremdherrschaft zu leisten, den die Moskauer Deklaration im Oktober 1943 vom österreichischen Volk einforderte.
Januar 28, 2026
Januar 28, 2026
Januar 28, 2026
Januar 28, 2026